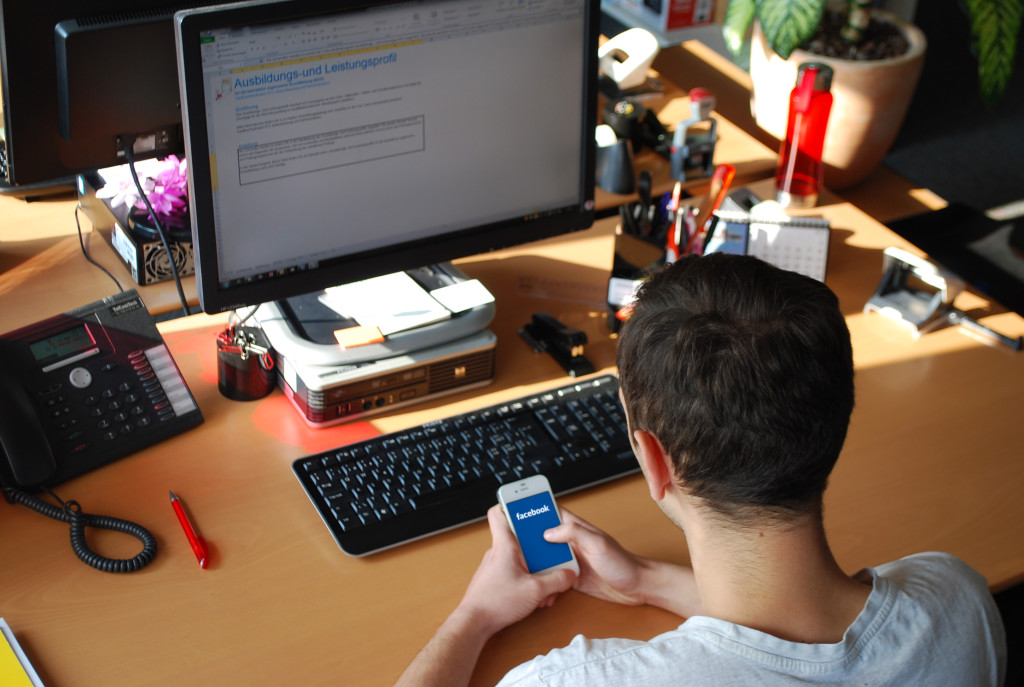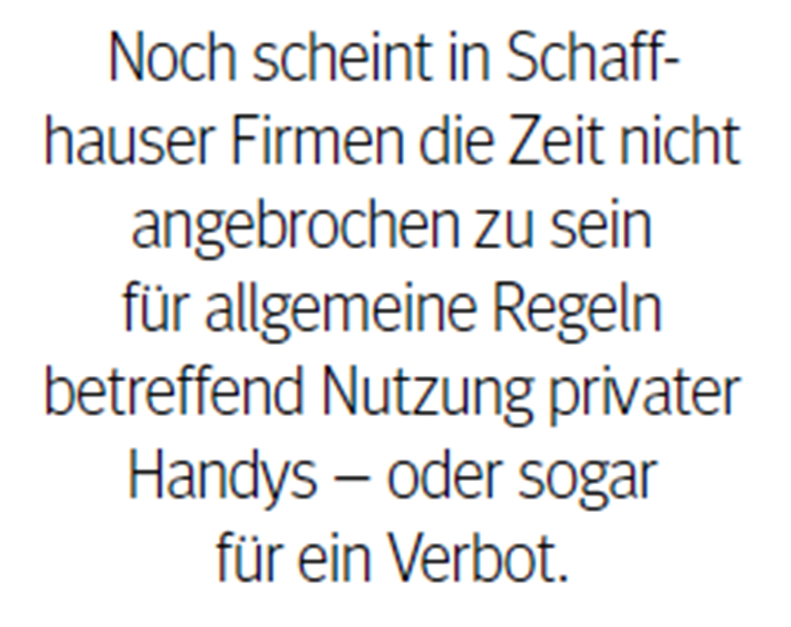Von Hermann-Luc Hardmeier. Immer mehr Schweizer Firmen stellen Regeln für den Handygebrauch am Arbeitsplatz auf. In Schaffhausen sieht es anders aus, wie eine Nachfrage von Hermann-Luc Hardmeier für die Zeitung „Schaffhauser Nachrichten“ zeigt.
Bild: Allgemeine Regeln für den Handygebrauch am Arbeitsplatz gibt es nur in wenigen Schaffhauser Firmen. (Foto: Hermann-Luc Hardmeier, Bericht: Hermann-Luc Hardmeier)
Schaffhausen. Am Arbeitsplatz private SMS verschicken, während der Sitzung einen Tweet absetzen oder kurz überprüfen, wie die aktuelle Auktion bei Ricardo
verläuft – immer mehr Firmen klagen schweizweit über das Problem des privaten Handygebrauchs am Arbeitsplatz. Diese Beobachtung macht auch Produktivitätstrainer Willy Knüsel bei seinen Kunden. Zu ihm kommen grosse und kleine Firmen, um ihre Sitzungen effizienter zu gestalten. «Das Handy am Arbeitsplatz ist ein Problem», bestätigt er. Um konzentriert und störungsfrei arbeiten zu können, entwickelt er darum mit seinen Kunden Benimmregeln für den Umgang mit Smartphones und privaten Laptops. Damit ist er nicht allein: So hat etwa der Milchverarbeiter Emmi Empfehlungen
zum Umgang mit Mobiltelefonen an Sitzungen erlassen.
Regeln unnötigÂ
In Schaffhausen sieht man das Problem offenbar wesentlich entspannter, wie eine kleine Umfrage bei hiesigen Unternehmen und Institutionen zeigt. «Allgemeine Regeln für den Gebrauch des Mobiltelefons in Sitzungen gibt es nicht. Doch steht es dem Sitzungsleiter frei, den Gebrauch der Handys einzuschränken», erklärt Heidi Elsenhuber, Leiterin Medien und Publishing bei Georg Fischer. Auch bei den Finanzdienstleistern scheint es keinen Handlungsbedarf zu geben. «Wir haben
keine Regeln», erklärt Daniel Brüschweiler von der Raiffeisenbank Schaffhausen.
«Wir appellieren an den gesunden Menschenverstand. In Anwesenheit von Kunden beispielsweise ist der Gebrauch des privaten Handys nicht angezeigt.»
Bei Jungen wie bei Erwachsenen
Daniel Brüschweiler erlebt den Umgang seiner Mitarbeiter mit dem Smartphone im Allgemeinen als diszipliniert. «Was mich gelegentlich schon gestört hat, ist der Eingangston von Mails, für jedermann hör- oder spürbar, wenn der ganze Tisch vibriert. Und mir fällt auf, dass vor allem junge Leute in der Pause lieber am Handy etwas machen, als mit den Kollegen zu kommunizieren.» Diese Beobachtung führt zur Frage, ob der private Mobiltelefongebrauch vor allem bei jungen Mitarbeitern problematisch
ist. Dem widerspricht René Schmidt vom KV Schaffhausen. «Sieht man einen jungen Menschen am Handy, glaubt man, er sei am Gamen oder schreibe SMS. Aber ist es etwa bei Erwachsenen anders?» Deshalb ist für René Schmidt auch klar, dass der
Handygebrauch am KV nicht speziell geschult werden muss. «Wir bringen den Lernenden vernünftige Verhaltensregeln bei.» Die Devise gilt: Wer den Knigge beherrscht, der merkt auch, in welchen Situationen der Gebrauch des Smartphones unanständig ist. René Schmidt räumt zudem ein, dass ein Verbot während des Unterrichts die Konzentration zwar verbessere, ein generelles Verbot aber sinnlos sei: «Im Betrieb, an Sitzungen und sogar im Parlament werden Mobiltelefone toleriert.
Eine Auseinandersetzung mit den Risiken ist also viel sinnvoller als ein Verbot.»
Schwierig bei Geschäftshandys
In einigen Firmen erhalten Mitarbeitende ab einer gewissen Funktionsstufe Geschäftshandys. «Dort ist es schwierig zu unterscheiden, was privat und was geschäftlich ist», erklärt Daniel Brüschweiler. Und deshalb werden bei Geschäftstelefonen auch Regeln aufgestellt: «Private Gespräche mit Geschäftshandys sind grundsätzlich auf ein Minimum zu beschränken», so Heidi Elsenhuber. Doch da die Mehrheit der Mitarbeiter keine solchen Smartphones besitzt, kann man noch nicht von einem Trend zu mehr Regeln sprechen. Aufgrund der Rückmeldungen der Schaffhauser Firmen kann man ein
Fazit ziehen: In der Munotstadt scheint derzeit noch nicht die Zeit für allgemeine
Handybenimmregeln oder sogar ein Verbot angebrochen zu sein. Treffend fasst Daniel Brüschweiler die aktuelle Situation zusammen: «Ich hoffe, dass wir dieses Thema noch möglichst lange auf einer Vertrauensbasis bewältigen können.»
Von Hermann-Luc Hardmeier. Erschienen in der Zeitung „Schaffhauser Nachrichten“ a 26.3.2015 im Ressort „Regionale Wirtschaft“.