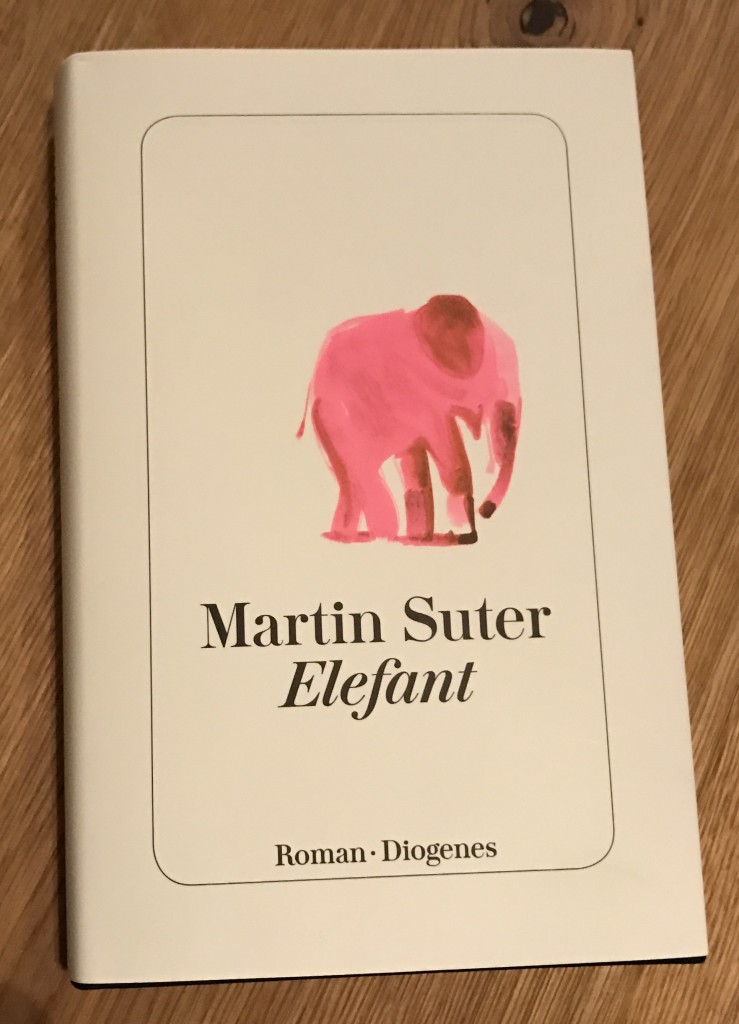Der Schweizer Autor Martin Suter trat am 22. Februar 2017 im Kaufleuten Zürich auf. Anlass dafür war die Präsentation seines neuen Romans «Der Elefant». Vor 500 Gästen sprach Martin Suter über sein Buch, ob er die Gentechnik für gefährlich halte und wie er zu seinen Kritikern steht. Das Gespräch führt Katja Früh, die mit ihm zu Beginn seiner Karriere als Regisseurin zusammengearbeitet hat.
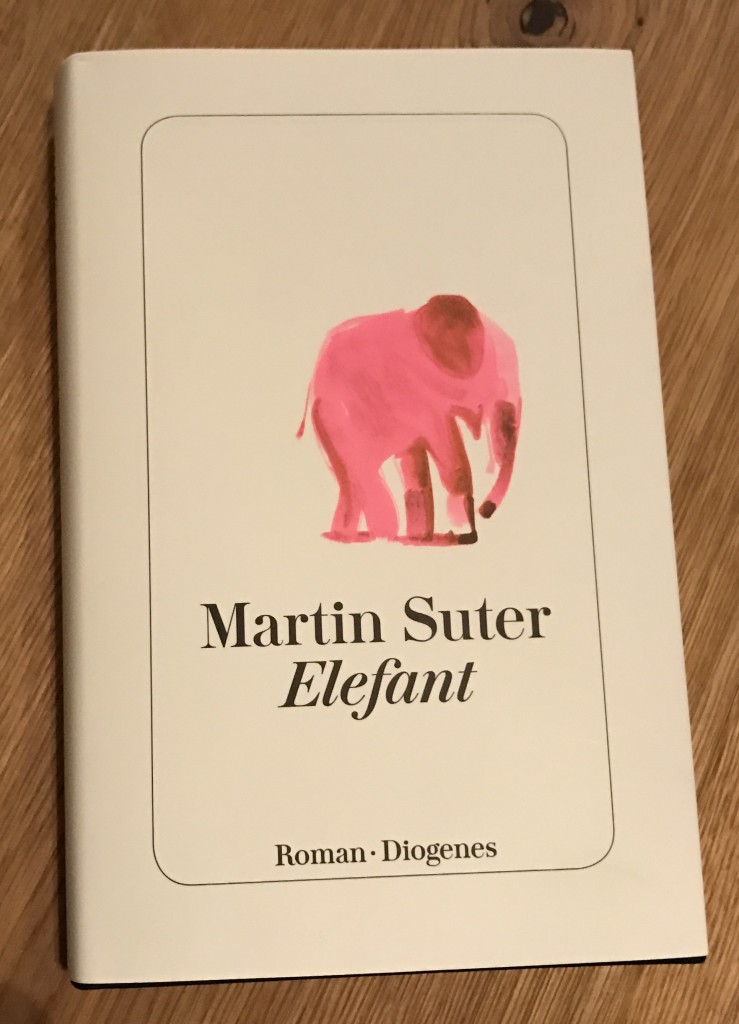
Das Gespräch der zwei wird im Folgenden möglichst wortwörtlich wiedergegeben, ist aber – der Lesbarkeit zuliebe – ein bisschen gekürzt. Verfasst von Hermann-Luc Hardmeier.
Sie haben eine Geschichte über einen wahnsinnig herzigen, kleinen, rosa leuchtenden Elefanten geschrieben. (…) ich war sofort verliebt, aber andererseits fand ich es total abgefahren. Wie kommt jemand auf einen rosa leuchtenden Elefanten? Haben Sie das im Alkoholrausch geschrieben?
Martin Suter: Ich war vor 10 Jahren an einer Alzheimertagung in Tübingen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde ich durch das Institut geführt. Der Professor Jucker sagte mir während der Führung nebenbei, heute könnte man gentechnisch auch einen kleinen roasroten Elefanten herstellen. Dieser Elefant ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Immer wieder dachte ich, das wäre doch Material für eine Geschichte. 10 Jahre später schrieb ich nun mein Buch darüber.
Gibt es wirklich leuchtende Tiere, abgesehen von Glühwürmchen?
Ja, das was Glühwürmchen zum Leuchten bringt, kann man gentechnisch benutzen, um auch andere Tiere zum Leuchten zu bringen. Googeln Sie einmal „Glowing Animals“, dann haben Sie den Bildschirm voller leuchtender Tiere. Auch kleine Tiere sind heute gentechnisch herstellbar. In China wurden Laborschweine aus praktischen Gründen in Miniatur hergestellt. Wenn man will, kann man sich diese nun als Haustiere kaufen. Bei Elefanten hat man es – soweit ich weiss – bisher noch nicht probiert. Mein Elefäntchen leuchtet von selber, es reflektiert nicht bloss. Es ist also gar nicht so völlig utopisch, was ich geschrieben habe.
Martin Suter liest aus dem Buch den Anfang der Geschichte.
Kurz vor dem Lesen hätte er gerne einen Schluck Wasser getrunken, doch die Wasserkaraffe auf dem Tischchen ist leer. Humorvoll bemerkt Martin Suter dazu. Normalerweise bestelle ich immer Wasser ohne Kohlensäure, doch jetzt habe ich nur die Kohlensäure bekommen.
Gentechnologie ist ein schwieriges Thema, bei welchem es viele verschiedene Meinung dazu gibt. In dem kleinen Elefanten sind alle Widersprüche zu diesem Thema drin. Wollten Sie etwas über Gentechnologie schreiben? War Ihnen das ein Anliegen oder wollten Sie einfach über den kleinen Elefanten schreiben?
Ich suche nie ein Thema und schreibe dann ein Buch dazu. Das ist auch okay, wenn man das so macht. Ich mache es anders, ich suche eine Geschichte und diese Geschichte findet dann selber das Thema. Ich gehe nicht mit der Absicht an ein Buch, eine Debatte neu beleben zu wollen.
Nach Ihrem Buch ist es schwierig, die Gentechnologie zu verteufeln. Denn wenn Sie solche Wesen wie das kleine Elefäntchen hervorbringt, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Man ist beinahe versucht zu sagen, Gott ist ein Gentechnologe. Dann gibt es im Buch aber auch ganz viele böse Menschen, die Fieses vor haben mit dem Elefanten. Stichwort: Geldgier. Und es gibt auch die Figur der Tierärztin Valerie, welche die Gentechnologie als Eingriff in die Schöpfung sieht. Wie stehen Sie zu diesem Thema?
Valerie sieht es ein wenig differenziert. Der „Elefantenbesitzer“ Schoch erhält bei ihr Unterschlupf und philosophiert einmal mit ihr. Beim Gespräch taucht die Frage auf, ist es ein Eingriff in die Schöpfung und in die Evolution sei? Valerie sagt, für sie sei es das gleiche. Diese Unterscheidung sei lediglich eine Zeitfrage. Die Schöpfung dauerte sieben Tage und die Evolution einige 100 Millionen Jahre. Sie glaube, hinter all dem stehe ein Plan. Die Gentechnologie greife in diesen Plan ein und sei deshalb unnatürlich. Ich persönlich glaube nicht, dass es ein heikler Eingriff in eins der beiden ist oder extremer ist als eine andere medizinische Entwicklung. Die Medizin machte immer extreme Eingriffe. Die Gentechnologie ist ja ein weiterer Fortschritt der Medizin. Ich wäre auch nicht froh, wenn man im Mittelalter aufgehört hätte, den medizinischen Fortschritt voranzutreiben. Sonst würden wir alle nicht hiersitzen. Ich glaube nicht, dass man die Gentechnologie verhindern oder sogar kontrollieren kann. Man müsste es, aber wir wissen ja alle, dass alles, was gemacht werden kann, gemacht werden wird. Wir können nur zuschauen und hoffen, dass es gut geht. Schoch sagt in diesem Gespräch, die Medizin sei ja auch ein Eingriff in die Natur. Sie erwidert darauf, „Nein, der natürliche Zustand ist gesund und die Heilung durch die Medizin stellt den natürlichen Zustand wieder her.“ Ich habe keine feste Meinung dazu, ob die Gentechnologie schädlich ist oder nicht und möchte auch keine feste Meinung vermitteln. Ich glaube einfach, man kann die Gentechnologie nicht aufhalten.
Die Alkoholiker sind in Ihren Büchern ein wenig die letzten Poeten. Die letzten grundguten Menschen. Das gefällt mir. Wie haben Sie diesbezüglich recherchiert? Sind sie mit diesen Herren zu einem Bier zusammengesessen oder wie haben sie bei diesen «Outcast» bzw. in der «Pennerszene» für Ihr Buch geforscht?
Das sind sehr tolerante Leute. Die sind wahrscheinlich uns gegenüber toleranter als wir ihnen gegenüber. In Zürich ist das sehr einfach. Die Obdachlosen oder Randständigen – im Schweizerdeutsch gibt es diesen sehr passenden Ausdruck – haben ein wunderbar gemachtes Strassenmagazin «Surprise». Das wird auf der Strasse verkauft, die Organisation unterstützt die Obdachlosen damit zur Selbsthilfe. Die Verkäufer dürfen die Hälfte des Erlöses behalten und können damit einen «Zustupf» zu dem verdienen, was sie zum Leben brauchen. Die Verkäufer machen auch Führungen durch «ihre» Unterwelt. Das sind mehrere Routen, zu welchen man sich anmelden kann. Das ist sehr interessant. Ich habe dies gemacht. Zwei praktizierende und ehemalige Obdachlose haben mir ihre Welt gezeigt. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie haben mir Details erklärt und mich herumgeführt.
Dieser Schoch….
Ach ja, ich wollte noch sagen. Man hat mich gebeten, nicht im Anzug an die Führung zu kommen. (Anmerkung: Martin Suter trägt in der Öffentlichkeit immer einen Anzug)
Und das haben Sie gemacht?
Ich habe die Krawatte dann weggelassen…
Also dieser Schoch, das ist ja ein Banker?
Jetzt haben Sie schon einen Teil des Clous verraten. Das kommt doch erst gegen den Schluss.
Entschuldigung. Also dann versuche ich es anders. Diese Liebesgeschichte ist schon sehr interessant. Hätte sich diese Valerie auch in jemanden verliebt, der nicht Randständig ist. Hat sie ein Helfersyndrom?
Es gibt eine Szene, in welcher er sich den Bart abrasiert und im Anzug ihres Vaters auftritt. Da stellt sie sich die Frage, ob sie so eine oberflächliche Person sei, dass er ihr nun ganz anders vorkommt. Ähm, warum habe ich jetzt das gesagt?
Weil ich wissen wollte, warum diese Liebesbeziehung funktioniert.
Ähm. Ich kann jetzt nicht sagen, kaufen Sie das Buch und die Antwort steht drin.
Ja, die steht nämlich nicht drin. Aber mich hat es beschäftigt, was sie in ihm sieht. Aber offenbar kann man dies rauslesen aus dem Buch.
Martin Suter nickt dezent lächelnd.
Der kleine Elefant Sabu. Der wird von verschiedenen Menschen anders gesehen. Der Tierpfleger Kaung aus dem Zirkus sieht in als heiliges Tier. Die andere Sicht: Es ist ein schützenswertes Wesen. Dann gibt es Menschen, die mit diesem Gentechnik-Produkt Geld verdienen wollen. Vielleicht kann man damit steinreich werden. Z.B. für Kinder, die schon alles haben als Spielzeug oder Haustier. Ich neige am ehesten zur ersten Sichtweise. Und Sie?
Mir gefällt die Sicht von Kaung am besten. Aber ich neige eben leider zur Sicht, dass es ein durchaus machbares gentechnisches Experiment ist.
Es lebt ja.
Ja. Es wird ja auch aus lebendigem Zellmaterial hergestellt.
Sie haben ja extrem viel recherchiert zum Thema Elefanten und deren Schwangerschaft. Das ist ja schon fast wissenschaftlich. Haben Sie eine spezielle Neigung dazu oder haben Sie ein Jahr lang dafür Bücher gewälzt?
Ich habe ein Zooabonnement. Ich gehe regelmässig mit der Familie in den Zoo. Ich habe keine besondere Beziehung zu diesen Tieren. Das ist alles recherchiert. Ich habe schon intensiv nachgeforscht, aber es ist nicht so, dass man sich da ein Jahr lang als ein Elefant verkleiden muss.
Aber es ist so sinnlich und genau!
Das ist die Fantasie des Schriftstellers.
Nun möchte ich noch auf die Kritik zu sprechen kommen. Wie gehen Sie damit um, dass die Kritiker immer von spannenden Büchern, raffiniert gebauten Plots, interessante Gesellschaftsthematiken und interessanten Figuren sprechen? Andere fragen sich, ob das noch Literatur ist. Weil es so spannend und so unterhaltend ist, darf man das noch zur hohen Literatur zählen? Stört Sie dies, dass man Sie in dieses Spannungsfeld wirft und sich fragt, ob das ernste Literatur oder Trivialliteratur sei?
Also ich habe dieses Problem ja nicht.
Nein, andere haben dieses Problem.
Es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie auch schon. Ich wollte ja schon lange Schriftsteller werden und schon lange zum Diogenes Verlag, weil dies der einzige Verlag ist, der dieses Problem im deutschsprachigen Raum nicht hat. Deshalb war ich so froh, dass ich dort landen konnte. Ähm. Literaturkritiker ist halt ein Beruf…
Das stimmt.
Ich schreibe Bücher und Kritiker kritisieren sie. Ich möchte auf keinen Fall tauschen.
Ich frage mich dennoch, warum dieser Unterschied in der Schweiz und in Deutschland so stark gemacht wird, zwischen «Unterhaltung» und «richtiger» Kultur. In England und in den USA wird das nicht unterschieden. Sie wären doch genau so jemand, der sehr gute Bücher schreibt. Man spürt, vielleicht sind sie zu erfolgreich. Vielleicht stört die Kritiker das. Sie erfinden dann Ausdrücke wie «Es sei eine philosophische Schöpfungsreflexion» und solche Dinge.
Hmm, können Sie mir diese Kritik mailen?
Ja, kann ich. Aber die Frage stellt sich. Darf man das? Oder ist das überladen?
Ich glaube, ich wäre schlecht beraten, wenn ich mich über die Kritiker beklagen würde. Im Grossen und Ganzen haben sie es in den letzten 20 Jahren sehr gut mit mir gemeint.
Aber das mit der Unterhaltung…
Ja, bei mir ist es so, dass ich versuche so zu schreiben, wie ich gerne lesen würde. Wenn dann die Formulierungen und Stimmungen, die Gerüche und die Bilder nicht abendfüllend sind, dann brauche ich etwas, was mich zum Weiterblättern treibt. Darum versuche ich immer spannende Bücher zu schreiben. Ich bin auch einer, der sehr schnell ein Buch weglegt, wenn er nicht in die Geschichte «hineinkommt». Und das versuche ich zu vermeiden. Und vielleicht bin ich auch einer von den Lesern, der dies erwartet von der Literatur. Es gibt auch ganz grosse Schriftsteller – Ich darf jetzt keine Namen sagen, ansonsten heisst es wieder, ich vergleiche mich mit denjenigen – ….
Georges Simenon?
Ja…
Shakespeare?
Ähm, selbstverständlich. (lacht). Nein, vielleicht Joseph Roth. Das darf ich sagen, weil ich ja einmal den Joseph-Roth-Preis gewonnen habe. Ich finde es toll, wenn man kleinste Details beschrieben bekommt wie beispielsweise die Uniformen beim Radetzkymarsch bis auf das letzte Kautschukstäbchen am Kragen oder wenn man im Detail erfährt, wie jemand rasiert wird. Ich habe den Realismus gerne. Aber da gibt es wirklich grössere als mich.
Ja, mich interessiert einfach das Phänomen, warum man Unterhaltung und Literatur trennt.
Man muss eigentlich leiden, um ein Künstler zu sein. (lacht)
Sie haben in Ihren Büchern eine Vorliebe für Dinge, die es nicht gibt. Demenz, Amnesien, Rauschzustände, zwei identische Banknoten, Menschen, welche die Zeit leugnen, rosa Elfentanten. Das hat etwas Magisches und zieht sich durch Ihre Erzählungen. Man würde fast denken, Sie glauben an Wunder. Welches ist Ihrer Meinung nach ein Thema, welches sich durch alle Ihre Bücher zieht?
Ja, es gibt eines. Ich wusste es lange nicht. Jemand hat mich mal bei einer Lesung genau dies gefragt. Ich hatte keine Antwort. Ein Besucher hat dann beim Signieren gesagt: Ich weiss, was Ihr Thema ist. «Schein und Sein». Und damit hatte er gar nicht so unrecht. Es geht eigentlich in allen Geschichten ein wenig um das Thema «Identität». Das hat man im Kopf, im Gedächtnis und verliert es z.B. durch Demenz. Das ist eine Art roter Faden durch meine Bücher. Den habe ich aber nicht geplant. Aber offenbar fasziniert mich das. Es hat natürlich auch einen dramaturgischen Grund: Eine Geschichte ist dann interessant, wenn der Protagonist am Schluss des Buches ein anderer ist als am Anfang. Die Veränderung der Identität ist, seit es Geschichten gibt, am spannendsten.
Das gilt eigentlich auch für den Film und fürs Theater?
Da muss man unterscheiden. In einer Serie darf sich ein Protagonist nicht entwickeln, er muss die Erwartungen bestätigen. Wenn sich ein Seriendetektiv entwickelt, dann raubt er dem Zuschauer den Bestätigungsmoment. Der Moment, wenn man sagen kann: Typisch Sherlock. Aber in einer abgeschlossenen Geschichte ist es schon spannend, wenn sich eine Figur entwickelt.
Die Fragen zur Biographie zu Martin Suter wurden weggekürzt, da er sich dazu schon in vielen anderen Interviews geäussert hat. Die Lesung dauerte eineinhalb Stunden und wurde mit grossem Applaus und einer langen Signierstunde vom Autor beendet.
Von Hermann-Luc Hardmeier.